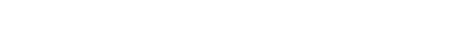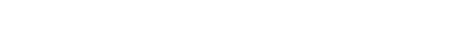„Die Prophezeiung der Volturne“
von Susanne O‘Connell
Das Reizvolle an einer Fantasy ist, dass alles Mögliche geschehen kann, so absurd erdenfremd auch immer. Das Geschehen muss keineswegs wahrscheinlich sein, nur der inneren Logik des phantastischen Konflikts gemäß. Freilich sollte es nicht ganz und gar ohne tiefere Bedeutung daher kommen. Susanne O´Connell scheint mir hierin eine wahre Meisterin. Ihre Story ist eine hochintelligente Parabel über höllische Zugzwänge des Individuums in einem sozialen Gefüge. Recht eigentlich durchaus menschliche Kalamitäten also, um die es geht, aber hinein projiziert in wundersame Gegenden, bevölkert von noch wundersameren Lebewesen. Deren machthungrig kriegerisches Treiben ist mit herrlicher Fabulierlust überaus bildhaft beschrieben, gekennzeichnet von urwüchsiger Freude am Erfinden von absurden Ereignissen, in die die befremdlichen Lebewesen verstrickt sind. Und dies garniert mit fabelhaften Wortschöpfungen sowohl hinsichtlich des Personals (Säbelzahntiger, Echsengreife, Wurmäugler, Reptogryph, Nephres, Kerentelschlangen usw.) als auch des übrigens Materials (Herzeapilze, Usurtusschnäbel, Furnellakraut usw.).
Ein imponierender intellektueller Kraftakt mithin. In einem Reigen toller Zufälle geraten die literarischen Protagonisten in Situationen von abscheulichster Konsistenz und noch abscheulicheren Gestanks. Skurril, grotesk, aberwitzig – Fantasy! Wobei Denkart und Verhaltensweisen insbesondere Vagóors, des Helden, und Mirihannas, seiner vergeblich Angehimmelten, irgendwie und überhaupt – wie bereits angedeutet - durchaus menschlich sind. Weshalb man ihnen denn auch gern folgt auf ihrem irre abenteuerlichen Feldzug, nämlich der Prophezeiung der Volturne zu willfahren.
Es geht um die Rettung eines ganzen Volkes! Eben der Volturne, denen die Herkane übel mitgespielt haben. Von der Autorin deliziös ausgedacht und beschrieben, begeben sich Vagóor und Mirihanna in gnadenlose Auseinandersetzungen mit diesen Herkanen, äußerst widerwärtigen Gestalten - Menschenfresser, wie sich herausstellt. Doch das ist noch nicht einmal das Ärgste! Sie haben die Volturne, neben den Menschen eine andere Sorte Lebewesen in diesem Fantasy-Universum, nicht nur gedemütigt, sie wollen sie endgültig auf ewig versklaven! Was nur dadurch zu verhindern ist, dass ein Volturne oder eine Volturnin die Aufgaben der Prophezeiung löst. So bangt man denn, ob es Vagóor gelingt. Was ihn zu einem Gott machen würde. Oder Mirhanna, seiner Angebeteten, welche wahrscheinlich eine Göttin ist! Was die ganze Angelegenheit noch geheimnisvoller macht. Die Erlöserin! Die aber, zwar vergöttert (offenbar wegen ihrer körperlichen Schönheit), überraschend versagt. Sie stirbt ziemlich sang- und klanglos. Weshalb der ganze existentielle Schlamassel an Vagóor hängen bleibt. Zugzwänge eben! Zu meistern nur mit Stärke im Glauben. Worüber Vagóor im wirklich allerletzten Moment denn doch verfügt. Frohe Botschaft also!
Wer ein Faible hat für solch abgründigen Taumel menschlicher Phantasie, kommt auf seine Kosten.
Veröffentlicht am 27. Mai 2015
„Durch Zeitstrudel in andere Epochen“
von Marlies Hanelt
Das Buch illustriert auf irrlichternde Weise die leider zutreffende Behauptung, dass sich die Spezies Mensch, um ihren Fortbestand zu gewährleisten, zum Monster wandelt und „Blut saugt“ - zu welcher Zeit und in welcher Epoche auch immer. Und dass diese abscheuliche Sucht im Grunde keine Zukunft hat, weil in Ewigkeit sich stetig wiederholend, von einer Zukunft in die nächste geworfen, also eigentlich ausweglos ewig gegenwärtig.
Welch kühne, welch tollkühne Thematik! Weil Marlies Hanelt keine wissenschaftliche Arbeit schreibt, sondern der Menschheits-Problematik per Fantasy zu Leibe geht, muss man keine letzten Antworten erwarten. Die es ja groteskerweise auch nicht gibt! Das mystische „Irgendetwas“, das bei der Autorin als Verursacher fungiert, wird von ihr nicht weiter hinterfragt. Ich würde unsägliche soziale Verhältnisse dafür schuldig machen. Doch in dem Moment, in dem ich dies niederschreibe, kommt mir in den Sinn, dass im Menschen – zumindest auf dieser unserer Erde – nach wie vor leider auch das Tier steckt. Hol’s der Teufel! Wie gesagt, die Autorin verstickt sich gar nicht erst in die vertrackte philosophische Problematik ihres Themas, sie schreibt wacker los.
Julia, also ein Mensch, hier eigentlich der abstrakte Mensch, hört die befehlende Stimme von „Irgendetwas“, wird per Horrortraum in einen barbarischen Strudeltunnel gesogen, fällt auf harten Untergrund und wandelt sich zum abscheulichen, auf Menschenblut programmierten Monster. Als solches gerät Julia, sich gar nicht mehr als Mensch begreifend, zwar „außerhalb von Zeit und Raum“, aber per Passage durch weitere abscheuliche Schlünde, in diverse Aggregatzustände sowie in diverse Handlungs- und Zeitebenen.
Noch eben vermutet man, den Monster-Menschen erwarten höllische Querelen in den tiefsten Schlünden der Tiefe, nein, er landet - um den blutsaugerischen Auftrag des mächtigen „Irgendetwas“ zu erfüllen - in profan irdischen Verhältnissen. Da gibt es einen subtropischen Urwald mit einer Forschergruppe darin, die für einen Pharmakonzern eine medizinische Heilpflanze sucht; da gibt es einen OP-Raum mit einer Forschergruppe darin, die für eine Organ-Mafia aus Leichen funktionstüchtige Organe zu reproduzieren versucht; und da gibt es eine hochmoderne Polarstation, in der eine tapfere Forschergruppe Bammel vor dem Schneemenschen hat und vom Monster Julia zumindest teilweise blutleer gesaugt wird.
Der mit Ursache und Wirkung frei spielende literarische Horrortraum zum anspruchsvollen Thema ist von der Autorin augenzwinkernd locker-salopp geschrieben, so dass der Leser das absurd-blutrünstige Geschehen denn doch nicht so ganz und gar ernst nehmen muss. Auch strahlen die Dispute zwischen den hinein positionierten Männern, so raubeinig und rüde sie verlaufen mögen, fröhliche Unbekümmertheit aus und erhöhen den Unterhaltungswert. Die übermütige, immer wieder überraschende Story provoziert beim Leser geradezu süchtige Neugier und lässt ihn nicht los, bis er zum Ende gelangt. Mit den allerletzten Zeilen erfährt er, dass sich die Spezies Monster-Julia - also der blutsaugende Barbar Mensch - im sich auflösenden Universum auflöst! Und es besteht keine Hoffnung auf wirklich menschliche Körperstrukturen in anderen, in besseren Universen! Wahrhaft gruselig!
Veröffentlicht am 12. Juni 2015
„Der Rollenkavalier“
von Ulla B. Müller
Zunächst hatte ich meine Schwierigkeiten mit diesem „Rollenkavalier“, dem Rentner Armin Sebeling. Welch ein Dussel aber auch! Läuft ihm doch die Frau davon, die Jutta, mit siebzig, weil sie offenbar einem Kerl begegnet ist, bei dem sie sich einen abwechslungsreicheren Lebensabend verspricht als beim pedantischen Armin. Und obwohl Armin die schöne Erkenntnis beseelt, seine Freiheit wieder gewonnen zu haben, verstrickt er sich prompt in eine neue Zwangslage, fast ärgerlicher als sein verkorkstes Eheleben. Immerhin gesteht er sich ein: „Ich bin so ein Idiot in letzter Zeit“. Aber er vermag seiner Trotteligkeit einfach nicht Herr zu werden. Worin ein guter Teil der anrührenden Komik dieses Buches besteht.
Armin ist auf die Idee gekommen, einen Rollstuhl zu Geld zu machen, das er dringend braucht. Das Gefährt, das für einen verstorbenen Mitbewohner im Mietshaus bestimmt war, eignet er sich einfach an und gerät natürlich in Verdacht. Was der Geschichte einen Krimi-Touch gibt. Fataler ist Armins nächste Lüge: Er spielt einer Frau, die ihm über den Weg läuft und die ihm gefällt, einen an den Rollstuhl gefesselten kranken Mann vor. Gewiss, das kleine Unglück, das Autorin Ulla B. Müller erfindet, um Armins Einfall wahrscheinlich zu machen, überzeugt trotz seines grotesken Zuschnitts. Doch dass Armin das Missverständnis nicht aufklärt, sondern meint, damit bei Rosalie erfolgreich zu sein, stempelt ihn endgültig zum Trottel. Wenn er sich in seiner Wohnung dazu aufrafft, Ausreden zu suchen, sie aber so laut meditiert, dass draußen vor der Tür die neugierige Hausbewohnerin Wilma, Rosalies Konkurrentin, aufmerksam wird und zuhört, dann sagt man sich, dem alten Mann ist nicht zu helfen.
Aber just diese Unbeholfenheit Armins gegenüber den Tücken des Lebens, die er letztlich immer wieder irgendwie meistert, um sich schon in der nächsten Kalamität zu befinden, machen den Kavalier auf Rädern ob seiner letztlich liebenswürdigen Schrulligkeit sympathisch. Zumal Ulla B. Müller die Widrigkeiten und Zufälle fabelhaft locker, herrlich genau und differenziert zu schildern weiß. Ob in Armins Wohnung, im Café, im Krankenhaus, in der Reha-Klinik, im Konzertsaal, im Schwimmbad - die Autorin kennt ihre Handlungsorte sehr genau und weiß obendrein ganz nebenbei immer wieder treffliche Anmerkungen übers ach so menschliche Miteinander zu machen. Etwa wenn sie in punkto Kindererziehung bissig feststellt, ein nötiges „Machtwort“ werde zuweilen schon als „Kindesmisshandlung“ betrachtet.
Mithin: Ich habe zunehmend mit Vergnügen gelesen und wurde immer neugieriger darauf, was Herr Sebeling wohl noch so anstellen wird, um seiner späten Liebe, der attraktiven Rosalie, endlich näher zu kommen. So skurril die eine oder andere Begebenheit sein mag, so überraschend auch die Wendungen der Geschichte, die Autorin hat sie sehr clever gefädelt. Besonders geglückt scheint mir die freundliche Art, wie sie das altehrwürdige potentielle Liebespaar nach der Serie von teils fatalen Missgeschicken denn doch noch zusammen führt. Jutta ist es, welch ein schöner Zufall, Armins geschiedene Ehefrau, die ihrem Verflossenen auf einem Tanzfest den Hinweis gibt, wo er Rosalie finden kann. Und wenn zum happy end auch noch Rosalies Sohn Alexander mit künftiger Ehefrau und Enkel auftauchen, alles von Armin insgeheim arrangiert, dann kann man wirklich optimistisch in die Zukunft schauen. Was heutzutage allerhand wert ist.
Nicht zuletzt: Ulla B. Müller liebt ihre Gestalten und scheint irgendwie stets ihre schützende Hand über sie zu halten. Sie mögen in noch so knifflige Situationen geraten, ihre Schöpferin lässt sie nicht im Stich. Ein kurzweiliges Buch von hohem Unterhaltungswert. Vor allem für jene, die Einsamkeit im Alter kennen und fürchten.
Veröffentlicht am 4. Juli 2015
„Flucht aus dem Morgenland“
von Mirja Jansen
Der Text ist ein kühner Spagat zwischen sachlichem Tatsachenbericht und erregender Räuberpistole. Einerseits notiert Bea, die Heldin, mit geradezu protokollarischer Akribie ihre mädchenhafte Naivität in punkto Männer und Liebe. Andererseits scheint sie maßlos zu übertreiben hinsichtlich ihres fatalen Schicksals. Ihr Eheleben in Jordanien, im erträumten Morgenland, ist nämlich alles andere als märchenhaft schön. Im Gegenteil. Ihr Traummann Majid entpuppt sich als Tyrann und Verbrecher. Aber genau darin wahrscheinlich liegen der Reiz und die Spannung des Buches. Man will nämlich einfach nicht glauben, was dieser Frau widerfahren ist.
Autorin Mirja Jansen arbeitet überdies mit einem „verfremdenden“ Trick. Sie verlegt die Handlung ihres Werkes nämlich in die Zukunft, in die Jahre um 2022 bis 2025. Damit hat alles Geschehen gewissermaßen automatisch eine gewisse Unwahrscheinlichkeit; denn es ist ganz offenbar und bewusst erfunden; es hat ja eigentlich noch gar nicht oder möglicherweise sogar überhaupt nicht stattgefunden. Man mag es daher glauben oder nicht. Andererseits kommt es mit einer solchen konkreten Bestimmtheit daher, dass der Leser sich der Ungeheuerlichkeit der Begebenheiten nicht entziehen kann.
Bea, eine junge Deutsche, vernarrt in Schneekugeln, überzeugte Bauchtänzerin, verknallt sich Hals über Kopf in einen Orientalen, einen - aus ihrer Sicht - faszinierenden Mann aus Jordanien. Da die junge Dame schon immer ein Faible hatte fürs Exotische, für Ali Baba und die Räuber wie für Aladins Wunderlampe, just für 1001 Nacht, hatte es der attraktive sexuelle Eroberer aus dem Morgenland nicht allzu schwer, ihr den Kopf zu verdrehen. Sie verfällt einer kopflos leidenschaftlichen Liebe – heiratet den Verführer noch in Deutschland (vierzig Brillanten auf dem Ehering!) und folgt ihm, dem begüterten Juwelier, nach Amman.
Und nun beginnt ein Martyrium. Bea spürt sehr bald: Sie ist in Majids Haus und Familie nicht willkommen. Von der Schwiegermutter wird sie ganz offenbar gehasst. Und Majid, ihr exotischer Super-Liebster, beginnt alsbald, sie zum Islam zu erziehen. Schritt für Schritt, Woche für Woche, Monat für Monat rüder und gewalttätiger nimmt er ihr alle Freiheit, versucht er, sie als Persönlichkeit zu brechen und zur verschleierten Haussklavin zu machen. Dazu gehört, dass er sie einerseits einsperrt und zum Koran prügelt, andererseits bei Bedarf gnadenlos vergewaltigt. Sie beginnt, ihn zu hassen. Als es ihr gelingt, Majids Vorleben und dessen erste Ehe zu erkunden, was ihn als Verbrecher entlarvt, hat sie endlich ein Mittel gegen ihn in der Hand. Sie bereitet ihre Flucht vor. Ein erregend schwieriges Unterfangen, dessen Schilderung leider ein wenig im Ungefähren bleibt. Man hätte schon gern gewusst, welche nützliche Rolle Beas oft bemühte Smartbrille letztlich gespielt hat, deren modernes elektronisches Geheimnis ihr Peiniger offenbar nicht kannte. Rettung kommt schließlich durch Rebecca, die Frau eines Ingenieurs aus Holland. Sie hilft Bea, Kontakt in die Außenwelt und nach Deutschland zu finden.
Autorin Mirja Jansen überzeugt mit ihrem Schreibstil, dicht und detailgetreu, psychologisch differenziert, sachlich offen bis in die „Bettmanöver“, zuweilen allerdings auch heterogen. Das sind dann meist die Momente, in denen man vermutet, dass diese abenteuerlich-bedrückende Geschichte denn doch erfunden sein könnte. Was die Autorin – sieh an! - in einem Epilog bestätigt. Wodurch freilich die dramaturgisch sehr gut gebaute Story, eben kein Report, sondern Produkt reicher Phantasie, an Ausstrahlung gewinnt. Frappierend die schonungslos selbstkritische Art, mit der diese Bea El-Naser ihr Frauen-Schicksal an sich vorüber ziehen lässt.
Das Leben ist kein Märchen, schon gar nicht aus „Tausend und einer Nacht“! Bea hat es schmerzhaft erfahren, und als Leser, der man ihr neugierig und voller Sympathie ins fremde Jordanien gefolgt ist, bangt und fiebert man mit ihr, obwohl man früher als die Heldin begreift, dass sie sich verirrt hat in eine fremde Zivilisation, die in ihrer geistigen Struktur noch tief im Mittelalter steckt, in das eine moderne, lebensfrohe Europäerin nicht zurück will und kann.
Veröffentlicht am 24. Juli 2015
„Der Augenblick mit dir“
von Alexandra Schumann
Will mir die Autorin ihre Geschichte „twittern“? Ich stutze und versuche, die Schreibweise zu definieren, die da auf mich zukommt. Mit knappen Sätzen und spritzigen Dialogen werden drei stürmende und drängende, merklich trinklustige junge Computer-Hengste vorgestellt, und Paul, einer von ihnen, landet prompt mit der attraktiven Ute im Bett. Quintessenz: „Er liebte Unkompliziertheit bei einer Frau, sowas war schwer zu finden!“
Alsbald spürt man, dass dieser flotte, zuweilen etwas flüchtig anmutende „Twitter-Stil“ sozusagen nur der Haken ist, mit dem vor allem junge Leser geangelt werden können. Da wird nämlich sehr geschickt erst einmal deren derzeitige Lese-Gewohnheit bedient. Und so sie gewonnen sind, macht Autorin Alexandra Schumann die „Kompliziertheit bei einem Mann“ sehr dezidiert und behutsam zum Motto ihres Romans, klopft es feinfühlig ab auf seine Tauglichkeit in punkto Liebe und Ehe, verlässt also den „Telegramm-Stil“ und findet eine psychologisch einfühlsame, detailfreudige Schreibweise. Wobei sie ihrem Motto treu bleibt, obwohl sie als Nebenhandlung eine Story eingebracht hat, die, ausgelotet, eine amüsante Komödie abgeben könnte.
Und zwar: Daniel möchte sich ein Reihenhaus bauen. In Eigenleistung! Sozusagen in Selfie-Manier. Seine Freunde Paul und Nico wollen ihm helfen. Die des Bauens völlig unkundigen Drei denken, Hausbauen ginge so leicht wie eben mal ein Bier kippen. Sie buddeln los, sie mauern wacker, verzichten also auf jeden Fachmann – und siehe da, sie schaffen den Rohbau. Im Roman! Offen gesagt, diese Baukunst von Laien hat mir die Haare zu Berge stehen lassen. Besonders wunderlich fand ich obendrein den Daniel, den finanzkräftigen Bauherrn. Der tritt, wenn’s ans Zufassen geht, stets in noblem Anzug an, weil er passende Klamotten nicht hat oder – was weiß ich – zu faul ist, welche zu kaufen. Wie gesagt, da steckt das Potential für Komik. Zumal im Verlaufe des Baugeschehens denn doch – und natürlich säumige! - Handwerker eingreifen müssen.
Alexandra Schumann indessen widmet sich ganz ihrem Helden, dem Paul. Der hat zwar – wie gesagt - berauschenden Sex mit Ute, aber das war es denn auch schon. Und nun zweifelt der junge Mann an sich, fragt, ob er gar das Debakel selbst verschuldet haben könnte oder ob er einfach an die falsche Frau geraten ist. Bei Linda dann läuft das ganz anders. Da ist er nicht auf äußerliche Schönheit fixiert, sondern kapiert langsam, wie „wirklich richtig hübsch“ Linda eigentlich ist, und zwar „von innen heraus“. Er ist so hingerissen, dass er schon mal ziemlich alkoholisiert Auto fährt.
In einer klugen Mixtur von Skizze und detailgetreuer Schilderung entwirft die Autorin – ohne Zweifel ein Erzähl-Talent von schöner Ursprünglichkeit - ausgesprochen liebevoll das Bild einer allmählichen Annäherung zweier Liebenden. Übrigens mit komischen Akzenten. Wenn Paul zum Beispiel mit der ihm im Grunde noch völlig unbekannten Linda in den Urlaub fährt, der eigentlich mit Ute geplant war. Zum Glück lassen sich im Urlaubshotel die beiden Betten auseinander schieben. Was natürlich nur ein Manöver ist. Doch nach dem Ereignis zweifelt Paul mal wieder an aller Liebe, weil er gedacht hatte, nach der lustvollen Begegnung im Bett sei alles paletti; die Linda ihn aber – auch für den Leser überraschend! - erst einmal wieder ausbremst. Da ist gute Menschenkenntnis im Spiel!
Folgerichtig weitet die Autorin ihr Motto „Kompliziertheit des Mannes“ aus zur Frage: Wie bauen Mann und Frau Vertrauen zueinander auf. Und was folgt, wenn sie sich endlich zusammengerauft und geheiratet haben? Im löblichsten Falle das eigentliche Lebensglück: Die intakte Familie! Alexandra Schumann weiß dies vorzüglich zu demonstrieren, wobei sie mit Feiern und Partys nicht spart, mit Alltäglichkeiten allerdings wohl doch ein wenig zu ausführlich ist. Und welche Freude: Das junge Paar wird ein Kind haben! Beglückende Folge des Urlaubs. Wenn auch nicht ohne Komplikationen. Und als der Bub dann endlich da ist, verkündet die Schwester strohtrocken: „Alles dran!“ Solch treffliche Lakonismen beherrscht die Autorin; wie übrigens auch, die Nebenfiguren immer wieder passabel einzubringen.
Anrührend zum Beispiel wie Paul erfährt, dass sein Freund Nico schwul ist, und wie er dem leidenschaftlichen Musiker zur Seite steht. Geradezu klassisch der besoffene Daniel, der zwar nun ein Haus besitzt, aber an seinem Glück zweifelt. Dass er eine Skifahrerin zufällig wieder trifft, die er vor Jahren auf der Piste rammte, mag unwahrscheinlich sein, ändert aber nichts an der Glaubwürdigkeit der wesentlichen Geschehnisse dieses Romans. Insofern kann von „Schnulze“ keine Rede sein. Ansteckende Aufgeräumtheit und gute Laune sind gleichsam Markenzeichen der Autorin. Freilich ist die Substanz ihrer lebenswahren Geschichte ausgeschöpft, sobald das Eheglück nicht mehr steigerbar ist.
Was man ahnt, was literarisch gesehen gewissermaßen kommen muss, geschieht: Ein tragisches Unglück zerstört alle Hoffnung, alle Sehnsüchte. Ich möchte das bedauerliche, leider durchaus realistische Schicksal dieser Familie hier nicht weiter ausplaudern. Aber gesagt muss werden: Die Autorin hat dazu eine nun wahrlich himmlische poetische Idee. Fast kindisch, durchaus kindlich, aber von tiefer Bedeutung für Erwachsene kontert sie die wehe Tragik mit einem skurrilen Märchen, das letztlich und eigentlich gar keines ist; denn es postuliert eine zwar äußerst bittere, aber ernste Konsequenz: Der Mensch muss „loslassen“ können im Leben, selbst von lieben Angehörigen, die verstorben sind. Hier lebt der Geist eines Humanismus, den ich mag. Fünf Punkte.
Veröffentlicht am 9. August 2015
"Rosafarbenes Morgenlicht draußen"
von Evelyn Safian
Zugriff auf Realität. Beherzt. Unerbittlich. Politisch souverän. Dies die ersten Eindrücke von Evelyn Safians Roman – Eindrücke, die sich über rund 300 Seiten immer wieder bestätigten. Die Autorin porträtiert soziale Widersprüche der wirtschaftswunderlichen Bundesrepublik in der Zeit der 68er-Revolte, als junge Linke das „Schweinesystem“ in Frage stellten. Mit gewisser Überraschung registrierte ich, dass sich darüber so spannend wie unterhaltsam schreiben lässt. Und welche Schicksale!
Im Zentrum steht Hanna, eine junge Frau und Mutter, unglücklich verheiratet mit einem typischen Haustyrannen der bundesdeutschen Männergesellschaft. Sie sucht nach echter Emanzipation, die sie bei der Lesbe Brigitta nicht findet – wobei sie peu à peu ihre eigene lesbische Neigung entdeckt. Wirklich verliebt ist sie allerdings in den smarten ungarischen Aristokraten Laszlo, von dem sie ihr Kind hat, was ihr Ehemann Martin nicht weiß, der Ludwig für seinen Sohn hält.
Die Konfliktkonstellation mutet zunächst unwahrscheinlich an, zumal bei einigen Personen Biographien hinzukommen, die zurückreichen in antifaschistische und in faschistische Aktivitäten. Weil aber alle Vorgänge in ihrer Ursächlichkeit erfasst und unaufdringlich geschildert sind, bin ich ihnen sehr gern gefolgt. Selbst an den Stellen, an denen die Autorin flüchtig zu sein scheint. Phasen situativ sehr präziser und äußerst empfindsamer Erzählung folgen Zeilen etwas hurtiger, stichwortartiger Mitteilung. Auch mag der eine oder andere Dialog etwas überzogen oder ein wenig plakativ geraten sein. Insgesamt pflegt die Autorin einen aufgeraut drastischen, assoziativ zerklüfteten Schreibstil, locker, unmittelbar, ohne Schnörkel, stets bildreich und der konkreten Realität verpflichtet. Das überzeugt.
Hanna verlässt ihren Mann, flüchtet zu ihrem Geliebten, dem Vater ihres Kindes, fühlt sich in den USA aber nicht wohl und kehrt zurück. Ihr wird klar, dass wirkliche Emanzipation der Frau dann beginnt, wenn sie arbeitet und also wirtschaftlich frei und unabhängig sein kann. Sie will Psychologie studieren, will frei sein und nicht zurück in ein „Ehegefängnis“.
Dramaturgisch klug, geradezu raffiniert bündelt und verfolgt die Autorin mehrere, mit den historischen bundesdeutschen RAF-Aktivitäten verwobene Konfliktstränge - Hannas hartnäckiger Kampf um absolute Eigenständigkeit, deren quälendes Hin und Her zwischen zwei Männern, deren Ausgeliefertsein an ihre lesbische Veranlagung und damit Abhängigkeit und Hörigkeit gegenüber der Sexbombe Brigitta, deren politischer Widerstand gegen die revoluzzernde Freundin, deren stille Sehnsucht nach Geborgenheit, Zuverlässigkeit und heiler Familie. Das ist frappierend! Das ist einfach gut vor allem auch wegen der psychologisch subtil gezeichneten Charaktere. Kolportage – dies mein einziger Einwand – ist RAF-Brigittas geile lesbische Leidenschaft während eines tragisch endenden Banküberfalls.
Am Ende bleibt allein der Titel „Rosafarbenes Morgenlicht draußen“ Verheißung sozialer Erneuerung, ansonsten kehrt satte Konvention zurück. Ein ehrliches Ehe- und Familiendrama von wahrhaft historischer Dimension. Ich scheue nicht den Vergleich mit dem literarischen Format eines Heinrich oder eines Thomas Mann, wobei man dann allerdings situative und stilistische Ungereimtheiten anmerken muss. Dennoch: Absolut fünf Sterne.
Veröffentlicht am 15. September 2015
"Kammerflimmern & Klabusterbeeren"
von Rafael Eigner
Plapper-Prosa ist in! Behauptet der Feuilletonist einer prominenten Tageszeitung. Liest man Rafael Eigners Roman „Kammerflimmern & Klabusterbeeren“, scheint das absolut zu stimmen. Wobei bei Eigner obendrein auf besondere Weise geplappert wird. Da schreiben sich nämlich zwei grotesk Verliebte tage- und also seitenlang eine SMS nach der anderen. Das anfängliche geistige Beäugen und spätere erotische Gezwitscher nervt und unterhält. Je nachdem. Es nervt, weil sich Statements, Witzeleien und Blödeleien zwar kunterbunt abwechseln, aber gnadenlos dahinziehen; es unterhält, weil die zwei Schreiber hochintelligente Leute sind, die sich ihre kobolzenden Geistesblitze so beherzt ausdauernd und zauberhaft schnodderig um die Ohren hauen, dass man einfach zustimmen muss. Zumal sich peu á peu ein amüsanter Konflikt entwickelt.
Benny, der Held des Romans - stressgeplagter, versierter Assistenzarzt einer Klinik, gut gelaunter, ehrgeiziger Popsänger zum Feierabend - hat sich nämlich eines Tages so voll laufen lassen, dass er sich nicht nur arg verletzt hat, sondern auch noch von einer zufällig daher kommenden schönen Unbekannten nach Hause geschleift worden war. Dort hat er sich im Suff die lädierte Augenbraue genäht und auf die Schöne einen super Eindruck gemacht. Aber das Fatale: Er kann sich an nichts erinnern! Nicht einmal an die Frau! Also ist er überglücklich, als die Fremde sich nach vierzehn Tagen meldet. Worauf denn die Aufklärung des Falles per SMS beginnt – und eine höchst romantische Liebe. In Ricky, die Benny nicht kennt, der er aber regelrecht verfällt. Denn sie ist ein verdammt kluges Luder. Genau das wunderbare Miststück, wonach sich Benny sehnt. Er will die Traumfrau total. Hirn und Arsch und Seele!
Doch die Vergötterte, inzwischen in Mallorca wohnhaft, entpuppt sich als kapriziöse Zicke. Sie zaudert, sich alsbald mit ihrem Verehrer zu treffen. Er: „Bist du meine Zukunft?“ Sie: „Ich bin deine Gegenwart!“ Ziemlich dreiste Antwort von einer Angebeteten, die sich realer Nähe verweigert. Den im Endeffekt retardierenden Knoten der Handlung meistert der Autor, indem er das anhaltende SMS-Gebalze und -Gegirre mit „Seitensprüngen“ Bennys (Schlussfolgerung: „Nie wieder Sex ohne Gefühle!“) und diversen Krankheitsfällen aus der Notaufnahme der Klinik garniert. Wobei der Autor mit sozial genauer Charakterisierungskunst glänzt. Besonders deliziös: Die Notfall-Untersuchung des Ex der fernen Geliebten. Bei welcher Gelegenheit nicht nur Benny, sondern auch der Leser erfährt, warum Ricky zögert. Ein Schock für den Casanova, den „perfekt integrierten Außenseiter“. Die so locker wie souverän „geplapperte“ Story nimmt ein zunächst ziemlich anrührendes, alsdann fast märchenhaft schönes Ende.
Rafael Eigner ist nicht nur ein psychologisch äußerst kundiger, er ist vor allem ein exzellenter Erzähler. Sein mit hinreißender Chuzpe geschriebener Text ist faszinierend eloquent, cool, leger, drastisch und nicht zuletzt gut gebaut. Für jeden Leser eine Bereicherung. Fünf Sterne.
Veröffentlicht am 18. Oktober 2015
"Der perfide, schwarze Leuchtturmwärter"
von Marlies Hanelt
Stellen wir uns vor, bei trostlosem Wetter in einem Berliner S-Bahn-Zug eingequetscht in einem Abteil zu stehen – und der Zug rührt sich nicht. Eine Schneeflocke auf der Schiene. Oder ein Suizid da draußen irgendwo auf der Strecke. Sirene. Rettungswagen in der Ferne. Blaulicht. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Alltags-Horror pur. Was tut man? Man nimmt sein Smartphone und holt sich Marlies Hanelts neueste absurde Erfindung, den „Perfiden, schwarzen Leuchtturmwärter“ auf den Schirm. Der Text der leidenschaftlichen Spezialistin reicht just für die Zwangspause und überbietet den Horror des Alltags bei weitem. Er entführt an einen Sonnenstrand in der früh gegen vier Uhr, wo Julia, eine körperperfekte, in Wahrheit ziemlich verrückte, weil sexuell unbefriedigte splitternackte Schöne auf Erfüllung hofft. Welche prompt als sonnenbebrillter geheimnisvoller Fremder vor ihr steht, dem sie schon fast in Trance die Brille abnimmt. Worauf er die Hingerissene behutsam in seine sonnenkönigliche Leuchtturm-Kemenate trägt, wo er ihr eine Droge verpasst. Daraufhin erscheinen und verschwinden ein schwarzer Wärter in weißer Maske, ein blutendes Herz mit Mund, ein Penis als gezackter Dolch und Bälle, die eigentlich Fäuste sind. Alles unter dem herzigen Motto des Leuchtturmwärters: „Meine Lieblingsspeise sind schöne Frauen“. Als die Wirkung der Droge abnimmt, verlässt die benommene, blutende, noch immer nackte Julia unbehelligt den Turm. Doch wenig später, nun per Geisterschiff, nähert sich der Wärter erneut. Diesmal tödlich. So „kostet“ Julia „bis zum Tode“ aus, „was die Natur vorgesehen hat“. Im Tod finden beider Seelen „Liebe, Zärtlichkeiten und wohliges Miteinander“. Bevor man auf die Idee kommt, über Hanelts Schluss-Verlautbarungen nachzudenken, ruckelt die S-Bahn. Der Schaden scheint behoben – und die Zwangspause nicht ganz und gar leer.
Veröffentlicht am 1. Dezember 2015
"Wind von Westen"
von Cordula Broicher
Je länger man liest, desto mitfühlender wird man - für Bauern in einem Dorf bei Köln am Rhein in historischer Zeit, als die Franzosen die Kaiserlichen und die Preußen über den Fluss gen Osten vertrieben hatten. Im Namen der Freiheit, versteht sich. Doch wie das meist zu geschehen pflegt, klaffen verheißungsvolle Versprechen und gelebte Realität weit auseinander. Die oktroyierten Freiheitstänze um aufgestellte Symbole sind so gar nicht nach dem Geschmack der Bauern, die unter der Last der Besatzung leiden und unter Freiheit ganz etwas anderes verstehen.
Cordula Broichers Buch ist in gewisser Weise ein Kleinod. Die Autorin hat nach umfangreichen und sehr soliden Recherchen ihrem Urururgroßvater Balthasar Broicher ein literarisches Denkmal gesetzt, dem Pächter eines Klosterhofes in Wesseling am Rhein. Die Geschicke dieses gottesfürchtigen Halfen und seiner Familie behandelt sie mit subtilem Einfühlungsvermögen und entwirft ein brillantes literarisches Genrebild, dem man sich nicht entziehen kann und das einen - obwohl gelegentlich ein wenig weitschweifig - in den Bann zieht. Welch Sitten einst!
Balthasar, sechstes Kind seiner Eltern und in Sachen Erbe benachteiligt, ist in eine verheiratete Frau verliebt, in Agnes. Als deren Mann stirbt und für den Klosterhof schnell wieder ein Kirchhalfe gefunden werden muss, gelingt dem gerade 24jährigen jungen Mann das Unerwartete. Sehr behutsam, sehr genau erzählt die Autorin nun, wie Balthasar schließlich Vertrauen und Liebe seiner Agnes gewinnt und wie er Schritt für Schritt auch Vertrauen und Anerkennung im Dorf findet. Letzteres ist besonders schwierig, weil Paul, Agnes‘ jüngerer Bruder, sich den „Froschfressern“ angeschlossen hat, was zu Misstrauen der Bauern führte. Als Paul mit den erfolgreichen Franzosen wieder im Dorf eintrifft, sorgt das für neue Unruhe, aber erfreulicherweise auch für Schutz vor Plünderungen. Allerdings müssen für die Franken fortan Hand- und Spanndienste geleistet und ihnen muss Quartier gegeben werden.
Cordula Broicher wartet mit erstaunlicher Milieukenntnis bis in kleinste Details auf und schildert liebevoll kaleidoskopisch Trubel, Sorgen, Freuden und Mühen einer Dorfgemeinschaft. Da gibt es nicht nur Hilfe und Freundschaften, da gibt es auch Widersacher und Neider. Halfe Balthasar, ein aufgeklärter Christ, der weder an Werwölfe, Hexen noch Zauberer glaubt und Bücher schätzt, lebt geradezu vorbildlich Redlichkeit in wirren Zeiten - und es tut dem Leser gut, dass die Autorin ihren Helden und dessen Familie heil durch alle Fährnisse zu bringen vermag. Fünf Sterne.
Veröffentlicht am 7. November 2015
„Schatten des Wassers“ von Hiroaki Nagahiro
Ein Buch von kafkaesker Schönheit – mithin nicht jedermanns Sache. Der Titel „Schatten des Wassers“ weckt Neugier, und der Untertitel „Vom Einsamsein in der Gesellschaft“ lässt eine enttäuschte, wunde Seele ahnen. Der Zugang zu dieser Seele - stellt sich heraus - ist nicht eben einfach. In die Texte von Hiroaki Nagahiro, einem in Deutschland lebenden Japaner, muss man sich regelrecht einarbeiten. Keine geradlinig erzählte Geschichte, sondern anrührende Lebens-Erörterungen als Folge eines tragischen Ereignisses. Verwirrende Satzfolgen vermeintlich ohne Zusammenhang, aber von sympathischer Weisheit. Etwa: „Jeder neue Tag ist nicht selbstverständlich“. Oder: „Der Reichtum verwandelt sich irgendwann in Gerümpel“. Oder: „Jeder steht irgendwann ganz allein da“.
Dem Leser erschließt sich alsbald, dass hier ein überaus sensibler Mensch über die hässlichen Verwerfungen der Gesellschaft schreibt, und zwar an Hand seiner zentralen Gestalt, des Buchhalters Nakata, den er ins soziale Abseits geraten lässt, weil er der Ellbogen-Mentalität nicht gewachsen ist. Der Autor skizziert soziale Oberflächen und leuchtet zugleich ständig hinab in deren abgründigste Tiefen – und dies mit faszinierend poetischen Assoziationen, mit trefflichen Methapern, geprägt von berührender Menschenkenntnis.
Der redliche Herrr Nakata erlebt, dass die Firma, in der er zu arbeiten die Ehre hat und deren Stammsitz in England ist, in Deutschland durch geschickte Manipulation gar keine Steuern zahlt. Sein Gewissen treibt ihn um. Schließlich weist er seinen Geschäftsführer auf die rechtswidrigen Handlungen hin – und sieht sich entlassen. Der Pfarrer hilft ihm nicht, vermag ihn nicht einmal zu trösten. Weil: Der Pfarrer ist ein Beamter! Denn: „Bevor man anderen hilft, muss man die Gefahren, die dadurch die eigene Existenz bedrohen könnten, überprüfen.“ Herr Nakata findet sich in der Psychiatrie eines Krankenhauses wieder, wo er so nebenher mitbekommt, dass seine Frau inzwischen anderweitige Interessen hat. Herr Nakata bereut, „dass er an die Gerechtigkeit der Gesellschaft geglaubt hat“, wird depressiv, hadert mit seinem Schicksal. Er erkennt, dass Heuchelei heutzutage und hierzulande selbstverständlicher Alltag ist und berufliche Ehrlichkeit bei den Geld-Giganten der Wolkenkratzer absolut nicht gefragt. Die schlimme, himmelschreiend absurde, aber staatstragende Situation im globalisierten, zunehmend entnationalisierten Europa ist, dass der Staat Unternehmen rettet, die mit Milliarden Verlust in der Insolvenz sind und ihren heuchlerischen Managern hohe Abfindungen zahlen. Der allein gelassene Buchhalter Nakata, ein Bürger von frappierend logischen ökonomischen Einsichten in Sachen EU, gibt noch immer nicht auf. Rechtsanwälte können oder wollen nicht helfen, der Petitionsausschuss des Bundestages lässt ihn im Stich. Herrn Nakatas letzte Hoffnung ist die Justiz. Er muss einsehen: „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber auch rechtswidrig“.
Der Mensch – wie ein Käfer hilflos auf dem Rücken liegend und vergeblich zappelnd. Nagahiros Werk ist ein erschütterndes Zeugnis von der gnadenlosen Entfremdung des Menschen im Turbokapitalismus. In der Summe ein nachhaltiges Dokument nackter Verzweiflung über den Untergang das Humanismus in Europa. Es sollte Pflichtlektüre sein in den obersten Klassen aller Schulen.
Eindrucksvoll im Übrigen die beigefügten skurril-abstrakten Bilder Nagahiros. Große klagende Augen saugen die Aufmerksamkeit des Betrachters gleichsam magisch an. Wehmut, Schmerz, Einsamkeit. Die Bilder sind im Original gewiss farbig und in grauer Widergabe vom Verlag leider um ihre einmalige Wirkung gebracht.
Veröffentlicht am 23. Dezember 2015
„Zeitennehmer“ von Dietrich Kothe
Keine schnurstracks erzählte Kriminalstory, vielmehr ein kunstvoll gefügtes Konstrukt literarischer Erörterung eines Kriminalfalles mit existenzphilosophischem Schlussakkord. Die Absätze des Textes von Dietrich Kothe erscheinen wie monolithische Blöcke, fest ineinander gefügt sind Vorgänge, Dialoge und Monologe. Diese auffallende Vordergründigkeit des Formalen überrascht nicht bei einem Autor, der zugleich Bildender Künstler ist. Sein Zugriff auf Realität und deren literarische Formung erinnert mich an Barlach, dessen wunderliche Skurrilität in Sachen menschlichen Daseins Kothe meines Erachtens wohl gar überbietet. Wir leben halt in erbarmungslos perversen Zeiten.
Der des Lebens kundige Autor entwirft mit launiger Ironie akribisch das Porträt eines Jounalisten, Tom geheißen - ein Mensch, der gleichsam ständig neben sich steht, um sein Tun und Denken analysieren zu können. Anfangs liegt er allerdings wie eine Mumie eingewickelt im Bett eines Krankenhauses. Er ist nämlich brutal überfallen worden, wahrscheinlich weil Fotos, die er beim Brand des Schlosses eines Super-Reichen geschossen hat, Beweismaterial für Brandstiftung des Schlossherrn sein könnten – eines ehemaligen Schulfreundes.
Ausgehend von diesem offensichtlich kriminellen Tatbestand bedient der Autor psychologisch feinfühlig als „seelischen Stuhlgang“ zwei Erzähllinien – einmal das stupide Dasein Toms in der „Gesundheitsfabrik“ mit einem todkranken Bettnachbarn und zum anderen Toms Bemühung um Ablenkung, nämlich Kramen in den Erinnerungen an den „Edelfaulpelz“ Karl bezw. Charly bezw. Charles. Die Reminiszensen an diesen ehemaligen Mitschüler aus der Klosterschule, wo „fortwährend der Himmel auf dem Spiel stand“, bezieht Tom aus Notizen aus jener Zeit. Fazit der umfangreichen Einleitung: Charles hatte sich Ende der Sechziger im beharrlichen Widerstand gegen die schulischen „Dompteure“ zum „Gentleman“ entwickelt.
Nun also steht fest: Dieser Tom ist ein gründlicher, gewissenhafter Journalist und pflegt die Lebensprobleme, die ihm widerfahren, zwecks möglicher Klärung mehrfach hin und her zu wenden - ob nun live oder in der Erinnerung. Das ist vom Autor mit reizvollen Apercus garniert. Etwa: „…du hast dir bald gesagt, in diesem Job darf einen überhaupt nichts wundern.“ Oder: „Dieser Vakuumgesellschaft stopfen wir die Löcher.“ Oder: „Elsbeth – die wandelnde Gesprächsbereitschaft“. Oder: „Der kleine Mann hat eben nicht den Eierkopf für die Philosophie.“ Leider aber hält diese zu Ausführlichkeit verleitende poetische Struktur merklich auf. Das Geschehen zieht sich hin.
Auch Toms weiteres Schicksal behandelt der Autor mittels zweier Erzähllinien. Er schildert dessen anfängliche Genesung, während welcher er seinenHelden wieder in skizzierte Erinnerungen abtauchen lässt. Wie nämlich der ominöse Fall in den Achtzigern in Gang kam, wie der Chefredakteur ihn in tiefstem Vertrauen auftrug, einem vermeintlichen“Lustknäuel“ irgendwo am Starnberger See, festgehalten vom Fotografen Dittle, nachzugehen. Fürs Archiv, versteht sich. Und wie bei der Recherche vor Ort, bei der „verwöhnten Meute“ der „Scheckheft-Aristokratie“, unerwartet Karl auftauchte. Und wie er Kontakt mit seinem einstigen Freund suchte, der „mittels Heirat“ wohlhabend geworden war.
Immer wieder meiselt der Autor an den Situationen, verweilt bei den Umständen – und die Handlung scheint still zu stehen. Situation Brand des Schlosses anläßlich seiner Wiedereröffnung nach aufwendiger Restaurierung: Unter den illustren Gästen plötzlich ein sonderbarer Typ mit Sonnenbrille, Schlapphut und Koffer! Wenig später „Feuer!“ Und die Gäste als erste und coole Zuschauer. Und inmitten der angesichts der Feuersbrunst jauchzenden und klatschenden Menge der noch coolere Schloßherr. Seltsame Umstände. Tom vermag sie nicht zu kompensieren. Er begreift sich als journalistischen Lakai eines cleveren Machers, der mit Hilfe der Treuhand bei der Abwicklung des vereinnamten Ostens reich geworden ist. Noch träumt Tom davon, dem Staatsanwalt zuvor zu kommen. Doch statt zu genesen, gleitet er ab in den Wahnsinn und landet im Irrenhaus.
Wer gedankendichten, sezierenden sozialen Realismus mag, wird absolut auf seine Kosten kommen. Ein Buch von philosophischem Anspruch und origineller Spannung. Vom schließlichen Verlauf wird hier nichts ausgeplaudert. Es handelt sich wirklich um einen delikaten Kriminalfall, einen Aufreger von ganz eigener Art.
Veröffentlicht am 4. Februar 2016